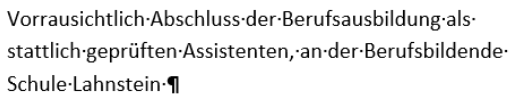Angefangen hat alles mit dieser Rezension in der Zeit: https://bit.ly/3DdpOAd. Obwohl ich dem Thriller- und Krimigenre schon vor einer Weile abgeschworen hatte, dachte ich mir, “das klingt doch gar nicht so übel”. Weil ich aber ein systematischer Mensch bin, entschied ich mich, mit Band 1 der einsilbigen Titel der Isa-und-Can-Reihe anzufangen und orderte diesen gebraucht. Mit dem Resultat, dass ein höchstens einmal gelesenes Buch ankam, in dem alle “bösen Wörter” durchgestrichen sind, außerdem Grammatik- sowie Rechtschreib- und andere Verlagsschlampigkeitsfehler angemarkert. Ist im Heyne-Verlag erschienen, war also zu erwarten – also das schlampige Lektorat, meine ich. Die Schimpfwörter sind von Frau Saygin, wg. Atmosphäre. Gegen Ende werden die Korrekturen weniger, es sieht aus, als hätte der Vorbesitzer angesichts der schieren Menge an Fluch und Fehlern die Freude am Rotstifteln verloren.
Worum gehts nun eigentlich? Zunächst die dramatis personae: Heldin Isa, Tochter aus gutem Hause, macht aber ihr eigenes Ding, klug und schön, mit tiefen Narben, kennt und hatte sie alle. Held Can, Sohn eines (türkischen, huiui!) Ärzteehepaares, spätberufener Polizist, die Sache mit den Frauen könnte besser laufen. Die Beiden leben schon seit immer in einer WG in Köln zusammen.
Dann Leichenfunde unter mysteriösen Umständen und im Laufe der Ermittlungen kommen Korruption, Karneval & Kölscher Klüngel, Menschenhandel & Fremdenhaß, globale und lokale Ausbeutung, Balkan, das Schicksal der Roma und internationale Verflechtungen ans Licht. Der Erzschurke ist ein Bauunternehmer, dem Gesetze, wofern nicht nützlich, so recht von Herzen gleichgültig sind und der sich für die Umsetzung seiner Ziele (im wesentlichen Profitsteigerung) rechtsradikaler Gruppierungen bedient. So weit, so nah am wirklichen Leben.
Frau Saygin hat für ihren Erstling mehr als fünf Jahre recherchiert. Diese Arbeit will ich in keiner Weise schmälern. Die Umsetzung in ein fiktionales Werk ist nicht ganz so gut geglückt, denn wir finden uns wieder in Klischeeistan. Blondinen gibts nur in Weizenblond, bei Alternativen riecht es nach Patchouli, Menschen in Angst tragen den Blick immer nach Innen gekehrt, der fotobegeisterte Jugendfreund hat es zu einem eigenen Ausstellungsraum im Moma gebracht, bei reichen Leute spazieren Pfaue auf dem wohlgepflegten Rasen des Landguts, Kommissar Zufall erweist sich zu oft als bester Kollege, Rechte tragen zuverlässig SS-Runen-Tätowierungen, Turnschuhe und Chinos und lassen sich dadurch auch in größeren Menschenmengen recht einfach als Verfolger herausfinden. Als wir Köln für die Welt verlassen, wird es nicht weniger holzschnittartig. Hmmm.
Das Buch ist nicht ganz schlecht, aber weit von richtig gut. Dennoch werde ich bei Gelegenheit auch “Clash” lesen. Und sei es auch nur, um herauszufinden, ob der Verlag inzwischen die Lektorenstelle besetzt hat und Frau Saygin sich freier geschrieben hat, denn Potential hat sie fraglos.