Auch wenn’s offensichtlich ein Schnäppchen ist – ich habe keine Ahnung, was mir mein Supermarkt hier verkaufen will…

Werte Letzte Generation,
mit eurer Klebeaktion gestern habt ihr den Freund aus Amerika bösen Unbillen ausgesetzt und ihn für ein paar lumpige Essens- und Übernachtungsvoucher stundenlang in vielellenlangen Schlangen auf dem FRAport herumstehen lassen. Dafür, dass er dann einen vergeudeten Tag Lebenszeit auf seinem Zettel zu stehen hat.
Das bitte ich doch künftig bleiben zu lassen.
Danke.
Seit gestern früh schmeckt die Luft morgens schon nach Herbst. Offensichtlich ist der bestellte Sommer noch nicht geliefert worden. Ich bitte dies dringend nachzuholen.
Or else.
Man unterschätzt sie gerne, die Apostrophe und meist ist eher ein Zuviel als ein Zuwenig zu beklagen. Nicht so vorhin in dem Buch, das ich gerade lese. Hell be the judge of that. Stand da. Hätte sich der Säzzer wie vorgesehen aus dem Apostrophenbeutel bedient, dann wäre zu lesen gewesen, dass er sich in einer Angelegenheit selbst eine Meinung bilden wird (he’ll be the judge of that) und die Verantwortung dafür nicht an Luzifer delegiert worden.
Angesichts des Schildes, welches “liebe Radfahrer” zu Wohlverhalten im Fußgängerbereich ermahnt, haben wir die Anrede gestern perfekt durchgegendert und werden sie zukünftig mit “liebende Radfahrende” überkleben.
Vorrede: Ich war schon letzten Samstag im Theater. Dass ich heute erst veröffentliche, liegt daran, dass die Bahn vollkommen gegen jede Erwartung meinen Besuch aus Amerika am Sonntag pünktlich hierher spedierte und wir die kurze gemeinsame Zeit intensiv ausgekostet haben.
Nun aber:
Ganz großes Kompliment dem Ensemble des Bauhoftheaters und ihrem Inszenator Robert Ortner, der in Personalunion auch für die Regie verantwortlich zeichnet, mit seinen Co-Regisseuren Patrick Brenner und Guido Drell, die in Personalunion die Hauptrollen geben. Es ist schon immer ein ganz besonderes Vergnügen, wenn Menschen, die ihr Handwerk verstehen, ihr Produkt präsentieren.
Taboris “Mein Kampf” beginnt in einer Obdachlosenabsteige in Wien, Stockbetten und Schmuddel, eine laute und unangenehme Wirtin nebst Gatten (Tina Rechl und Jakob Hirmer), die diesen armen Männern die mühsam erhandelten und erbettelten Groschen für ein Dach über dem Kopf aus dem Taschen ziehen. Alsda wären Lobkowitz (Lisa Hanöfner), Koch mit Gotteskomplex und der gute Schlomo Herzl (Guido Drell), Buchhändler, der mit einem Bauchladen nächtens in den Kaschemmen die Bibel, das Kamasutra und für die, denen das Buch der Bücher zu lang ist, das Neue Testament feilbietet. In den herrlichen Dialogen der Beiden werden ständig jiddische Witze mit ellenlangen Bärten erzählt, die dem Braunauer Publikum aber offensichtlich noch neu sind und herzlich belacht werden.
Zuwachs trifft ein. Der junge Hitler (Patrick Brenner), ein kleiner Gernegroß mit Großmaul sowie Strubbelhaar und fusseligem Schnauzer, der seinen Minderwertigkeitskomplex durch lange unreflektierte Wortketten wegdeklamiert, laut und ungezogen, gleich das beste Bett reklamierend sein Zeug durch die Gegend schlampt, in der selbstverständlichen Erwartung, dass hinter ihm hergeräumt werden wird. Ein unangenehmer kleiner Kerl, in heutiger Kategorisierung ein archetypischer Incel.
Schlomo ein Helfersyndrom zu unterstellen, wäre glatt untertrieben. Er nimmt sich des kleinbürgerlichen Landeis mit dem engen engen Horizont an. Ihm und seinen dummen Sprüchen begegnet er mit Großmut und Toleranz, speist und tränkt ihn, glättet sein Haar, stutzt den Bart zum bekannten Bürstchen zurecht, flickt ihm die Kleidung, unterweist ihn für sein Vorsprechen an der Kunstakademie und natürlich leiht er ihm seinen wertvollsten Besitz, einen warmen Wintermantel. Dankbarkeit für diese Großzügigkeit ist dem jungen Hitler fremd, er quittiert Herzls Entgegenkommen mit dummen antisemitischen Sprüchen – das Reden mit Rechten, noch dazu “auf Augenhöhe”, war und ist, so scheint es, zu keiner Zeit von Erfolg gekrönt.
Die bekannte Ablehnung seiner Bewerbung* an der Akademie ist jedermanns Schuld (außer der des Dilettanten Hitler, selbstverständlich), und ganz besonders Schlomos, der vergessen hat, ihm zu sagen, dass er eine Hose anziehen muss. Die sehr unsägliche ungut vergilbte lange Unterhose, die Brenners Hitler die meiste Zeit trägt, meine ich aus der Danton-Inszienierung von vor ein paar Jahren wiedererkannt zu haben. Sie ist nicht gut gealtert und macht den lumpigen Kretin noch einmal extra zur Lachfigur. Wobei – eben nicht! Brenner gelingt durchgehend der sehr großartige Spagat, die abgehackte, machmal kippende Sprache und Körpersprache Hitlers zu zitieren, ohne sie zu parodieren – eine ganz große Leistung. Auch könnte ich schwören, dass er im Laufe des Inszenierung und während seine Figur zum aufsteigenden Diktator mutiert, um ein paar Zentimeter wächst. Doch, doch.
Drell spielt seinen Schlomo Herzl in der guten Tradition des Lessingschen Nathan: er sieht zwar, dass möglicherweise gar nicht alle Menschen gut sind, so richtig begreifen kann er es aber nicht. Auch Drell gelingt hier ein beeindruckender Spagat, nämlich, dass dem Publikum seine fast masochistische Mütterlichkeit nicht auf den Wecker geht, sondern vielmehr Mitgefühl mit diesem guten Mann vom Männerasyl weckt.
Als Reibungsfigur zwischen diesen beiden Gegenpolmännern hat Tabori ein Gretchen (Jennifer Kastinger) hineingeflanscht (jaha, wir haben alle die Faust-Anspiel- und Anleihungen verstanden, jaha), deren Verführungsversuche sich in Pediküren auflösen (a) das Kind ist noch so jung und b) was würden die Leute und die Ordnungsmacht sagen, alter Jude und deutsche Jungfrau…) und deren größtes Geschenk an Schlomo ein Huhn ist. Auf dass es ihn wärme, das Huhn Mizzi**. Das Huhn wird später gegrillt und zum Symbol erhoben werden (“Wenn ihr beginnt, Vögel zu verbrennen, werdet ihr enden, Menschen zu verbrennen.”) – wie so vieles in einer grotesken Komik überzeichnet. Einem der Höhepunkte, dem wortmächtigen Solo als Frau Tod ist Gabriele Pointner leider sprachlich nicht ganz gewachsen, das ist schade, aber auch der einzige Wermutstropfen in dieser ansonsten sehr gelungenen Aufführung.
Nachtrag: Ich beneide die Dramaturgen des Bauhoftheaters nicht, denn sie werden auch in den kommenden Jahren wieder Stücke finden müssen, in denen Hans Dzugan einen seiner wundervollen Memento-Mori-Tod-Auftritte haben kann – ohne ihn wären die Abende sehr viel ärmer.
“Finita la commedia!”
Nachtrag 2: Mein Lieblingszitat, mit dem Tabori diesen dummen Hitlerbuben ganz herrlich demaskiert: “Schwerkraft? Ich habe noch nie viel von Schwerkraft gehalten.”
Nachtrag 3: Wie immer Dank an die Gastgeber*innen (Gastgebenden?) für alles.
* Die Bewerbungsbildermappe ist ein ganz besonderer (und wunderschön gemeiner) Augenschmaus. Und es wird lange dauern, bevor ich wieder eine Bildbeschreibung von “Wasauchimmer im Zwielicht” lesen kann, ohne schallend zu lachen. Lange.
** Ganz Braunau ist übrigens zugepflastert mit Werbung für “Mein Kampf”. Dass man darüber in der Geburtsstadt Hitlers dennoch grinsen kann, ist alleine Mizzi zu verdanken:

Ausgegraben aus dem letzten US-Wahlkampf, aber deswegen nicht weniger hübsch. Danke, Randy, wie immer.
Die Süddeutsche hält sich mit Hermann Unterstöger einen eigenen Sprachlaboranten, um so bedauerlicher ist es, dass sie maschinenübersetzte Texte nicht noch mal von einem der deutschen Sprache fähigen Menschen prüfen läßt.
Den Begriff “Selbstwehr” nämlich, den gibt es im Deutschen nicht. Selbstverteidigung? Ja. Selbstschutz? Auch ja. Aber das, was die Amerikaner “self defense” nennen (s. hierzu auch: Clapton, Eric), also sich gegen einen Angriff auf Leib und Leben möglicherweise mit Todesfolge zu verteidigen, ist im Deutschen die “Notwehr”.
Unterstöger: übernehmen Sie!
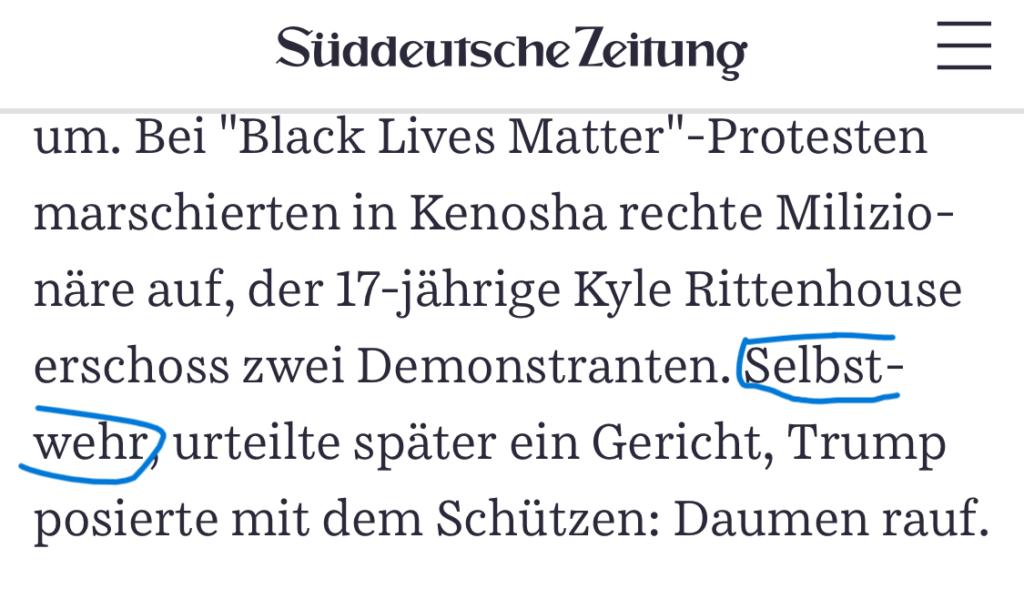
Das ärmste Opfer dieses luftfeuchten Sommers (wobei mir allein diese Bezeichnung für diese Scheußlichjahreszeit schon schwer aus der Tastatur kommt), das ärmste Geschöpf also unter diesen tiefhängenden Himmeln ist die gemeine Breze. Kaum ist sie aus der Auslage der guten Bäckerin in die Tüte gekommen, schwitzt sie sich und ihre Grobsalzgarnitur schon dermaßen in einen quatschig-matschigen Aggregatszustand, dass man eigens dafür einen erfinden müßte.
Dazu ein Trauerchor: “Laßt uns froh-ho uhund knusprig sein…”